Schrittweise Aufhebung des Strassenstrichs am Zürcher Sihlquai
Die Stadt Zürich wagt den Versuch mit einem in Altstetten gelegenen, neuen Strichplatz mit Boxen. Der Strassenstrich am Sihlquai wird ab Juni zeitlich eingeschränkt und ab 2012 ganz aufgehoben.
Brigitte Hürlimann
Es soll wieder besser werden in Sachen Prostitution in der Stadt Zürich: gesitteter, geordneter, ruhiger – und auch diskreter. Wenige Monate nachdem die Exekutive ihre Vorstellungen für eine neue Prostitutionsgewerbeverordnung bekanntgegeben hatte, präsentierten am Mittwoch drei Stadträte kurzfristige Massnahmen und die Vorstellungen darüber, wie es mit dem Strassenstrich weitergehen soll. Der landesweit berüchtigte Strich am Sihlquai, an dem Zuhälter ihr Unwesen treiben, Frauen ausgebeutet und misshandelt werden (auch von Freiern), soll ab Juni zeitlich beschränkt und ab kommendem Jahr vollständig aufgehoben werden. Bis zur Aufhebung dürfen die Prostituierten zwischen dem Dammweg und der Kornhausbrücke neu nur noch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ihre Dienste anpreisen.
Vorgespräch bei der Polizei
Ebenfalls ab Anfang Juni gilt für jene Prostituierten aus den EU-Ländern, die in Zürich auf dem Strassenstrich tätig sein möchten, ein neues Verfahren. Sie müssen sich für eine Vorprüfung zuerst bei der Stadtpolizei melden und gelangen erst in einem zweiten Schritt zum Amt für Wirtschaft und Arbeit. Die Stadtpolizei kontrolliert, ob die Frauen selbständig arbeiten und ob sie eine Krankenversicherung abgeschlossen haben. Die markanteste Veränderung in Sachen Strassenstrich steht jedoch, falls das Parlament den Plänen der Exekutive zustimmt, im Frühling 2012 bevor. Dann nämlich soll am Rande der Stadt, in Altstetten, in einem Brachland, eingeklemmt zwischen der Aargauerstrasse und der A 1, ein betreuter, gesicherter Strichplatz mit Boxen und Infrastruktur eröffnet werden: ein Novum für die Schweiz. Vorgesehen ist, mit zirka zehn Boxen sowie mit Standplätzen für Wohnwagen zu beginnen und damit erste Erfahrungen zu sammeln. Auf dem Areal befindet sich heute ein Containerdorf mit rund 130 Asylsuchenden; nach einer zusätzlichen Drittnutzung wird noch gesucht. Dem Stadtrat schwebt vor, den Strichplatz mit Sichtschutz abzuschirmen und so zu organisieren, dass die Freier mit ihren Autos Runden drehen können. Werden Prostituierte und Freier handelseinig, so fahren sie mit dem Auto in eine Box, wo dann eben das Geschäft stattfinden soll.
Nur noch drei Strichzonen
Sozialvorstand Martin Waser sprach offen von einem Versuch – und davon, dass man nicht wisse, ob es funktioniere. Für den Stadtrat steht fest, dass der Sihlquai aufgehoben werden muss. Gleichzeitig will man eine unkontrollierte Verlagerung des Gewerbes in andere Quartiere verhindern. Der heutige Strichplan, der diverse Zonen auf einer Länge von elf Kilometern vorsieht, wird aufgehoben. Neben dem Strichplatz mit Boxen soll noch ein zweiter Autostrich installiert werden, in der Allmend Brunau, sowie ein sogenannter Fussgängerstrich im Niederdorf – einem traditionellen Ausgehviertel, in dem bereits in früheren Zeiten entgeltlicher Sex auf der Strasse angeboten wurde. Beim Strichplatz und beim Autostrich in der Allmend ist die Frauenberatungsstelle Flora Dora anwesend, der Fussgängerstrich wird durch aufsuchende Sozialarbeit betreut; als flankierende Massnahme soll an der Zähringerstrasse neu ein Nachtfahrverbot erlassen werden. Der Stadtrat erhält die Kompetenz, separate Zonen für die Fensterprostitution zu bezeichnen. Prostitution in Häusern oder Wohnungen wird auf dem ganzen Stadtgebiet bewilligt, falls die baurechtlichen und die gewerblichen Vorschriften eingehalten werden.
Polizeivorstand Daniel Leupi sprach an der Medienorientierung von einer «Vision des Stadtrats»: In Zürich soll künftig ein Prostitutionsgewerbe existieren, das nicht stört, das die Würde aller Beteiligten und den Gesundheitsschutz gewährleistet. Allerdings nehmen derzeit die Geschlechtskrankheiten wieder zu, und zwar in erster Linie am Strassenstrich, wie Gesundheitsvorsteherin Claudia Nielsen ausführte.
brh. ⋅ Von einem Befreiungsschlag zu sprechen, ist nicht übertrieben. Der Stadtrat von Zürich hat genug von den Negativschlagzeilen rund um die Zustände am Sihlquai, hat genug davon, mit ansehen zu müssen, wie junge Frauen aus Osteuropa von ausbeuterischen Zuhältern auf den Strassenstrich geschickt, dort von ihren Aufpassern wie auch von Freiern misshandelt werden. Damit soll Schluss sein – spätestens in einem Jahr. Die Zürcher Exekutive verbannt den unliebsamen Auto-Strassenstrich an den Rand der Stadt. Dass sich allerdings der neue Strichplatz mit Infrastruktur – Boxen! – ausgerechnet auf einem Brachland befindet, auf dem 130 Asylsuchende im Containerdorf leben, mutet ein wenig zynisch an.
Deutlicher kann man nicht manifestieren, dass Prostituierte und Asylsuchende als Menschen am Rande der Gesellschaft eingestuft werden. Da sich der Stadtrat für das gleiche Stück Brachland noch eine Drittnutzung wünscht, lässt sich erahnen, was in Betracht gezogen wird. Ein Gefängnis? Eine Anlaufstelle für Drogenabhängige? Ein Alkoholikertreffpunkt oder ein Obdachlosenheim? In allen Fällen wären weitere Gruppen von Menschen betroffen, die gar nicht gerne in unserer Mitte gesehen werden.
Doch was ist dem Stadtrat anderes übrig geblieben, als jenen Teil des Prostitutionsgewerbes, der am meisten stört, an den Rand zu verbannen? Andere geeignete Orte hätten sich auf die Schnelle kaum finden lassen, denn niemand, der in Zürich wohnt und arbeitet, will direkt mit der Prostitution in Kontakt kommen. Und der Freierverkehr per Auto gehört unbestrittenermassen zu den lästigsten Erscheinungen des ungeliebten Gewerbes. Es ist deshalb vernünftig, den Autostrich an die Ränder zu beordern. Ob dann die Frauen auch problemlos und sicher an diese Ränder der Stadt gelangen und von dort wieder zurückkehren können, ist eine andere Frage. Zu hoffen bleibt, dass die Zürcher Bevölkerung die Entlastung als solche anerkennt und dafür die weniger störenden Formen der Berufsausübung eher toleriert: sei es der sogenannte Fussgängerstrich oder sei es die Prostitution in Häusern und Wohnungen.
-yr./brh. ⋅ Nach ähnlichen Problemen wie derzeit in Zürich ist in Köln der Strassenstrich vor zehn Jahren von der Innenstadt an den Stadtrand verlagert worden. Allerdings meinte im vergangenen Herbst der Verantwortliche in der Kölner Stadtverwaltung gegenüber der NZZ warnend, dass sich das Modell nicht zwingend eins zu eins auf andere Städte übertragen lasse (NZZ 20. 9. 10). Insbesondere wies er daraufhin, dass sich auf dem Kölner Strassenstrich vor allem Drogenprostituierte anbieten, die zumeist ohne Zuhälter arbeiten. In Zürich hingegen ist der Strassenstrich am Sihlquai zurzeit geprägt von jungen Frauen aus Osteuropa, die häufig von Zuhältern kontrolliert werden.
In Köln bedeutete die Verlagerung in die Vorstadt nicht weniger, sondern deutlich mehr Überwachung. So ist die Polizei über ein Alarmsystem jederzeit kurzfristig abrufbar, zudem sorgt ein caritativer Verein nicht nur für eine minimale Infrastruktur, sondern auch für eine gewisse soziale Kontrolle. Die acht Verrichtungsboxen wurden in eine alte Scheune eingebaut, wobei es sich um simple, auf alle Seiten offene Unterstände handelt. Mit einer einfachen baulichen Massnahme wurde erreicht, dass sich zwar die Beifahrertüre öffnen lässt, nicht aber die Türe des Autolenkers. Das erleichtert einer Prostituierten, die sich bedroht fühlt, die Flucht. Als Besonderheit gibt es in Köln auch zwei gesonderte Boxen für Fahrradlenker.
Für die Freier war die «Umsiedlung» an den Stadtrand offenbar ebenfalls kein Problem. Einzig von einigen Anwohnern gab es am Anfang des Projekts Proteste. Doch dieser Protest schlief nach Auskunft der Kölner Stadtverwaltung bald ein – in der Praxis habe es für die Anwohner keinerlei Belästigungen gegeben. Für das Gelingen des Projekts sei es aber ausserordentlich wichtig, dass alle involvierten Parteien einverstanden seien. Nur schon der Widerstand einer einzigen beteiligten Partei könne ein solches Projekt gefährden.
Polizeivorstand Daniel Leupi betonte an der Medienorientierung von Mittwoch, man habe sich in Sachen Strichplatz mit Boxen von mehreren deutschen Städten inspirieren lassen. Übernommen habe man die Sicherheitselemente: den Alarmknopf in jeder Box oder die fehlende Möglichkeit des Ausstiegs aus dem Auto für die Freier.
mbm. ⋅ Das vom Stadtrat geschnürte Massnahmenpaket zur Entschärfung der Problematik rund um die Strassenprostitution in der Stadt Zürich ist von den politischen Parteien unterschiedlich aufgenommen worden. So steht die städtische SVP der überarbeiteten Prostitutionsgewerbeverordnung sehr kritisch gegenüber, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Prostitution sei ein legales Gewerbe, in das sich der Staat nicht einzumischen habe. Dass der Sihlquai nicht mehr Teil des Strichplans sein soll, wird von der SVP hingegen begrüsst. Das eigentliche Problem liege beim Strassenstrich, der seit der Einführung der Personenfreizügigkeit richtiggehend explodiert sei. Es sei nicht zu verstehen, warum das Bundesgericht das Verbieten des Strassenstrichs nicht erlaube. Unverständlich sei aber auch, dass das Niederdorf im Strichplan bleiben soll.
Auch das Aufstellen von Sexboxen beurteilt die SVP kritisch. Diese seien bei den Frauen nicht besonders beliebt, weshalb die Polizei angehalten sei, die Situation im Umfeld genau zu kontrollieren. Die FDP will genau beobachten, wie sich die Lage an den drei Standorten entwickelt. Eine zusätzliche Bürokratisierung, wie sie wegen der Bewilligungspflicht und der Vorschriften für die Salons droht, will die FDP nicht. Da werde eine Sicherheit vorgegaukelt, die man gar nie erreichen könne.
Für die CVP des Kantons Zürich sind Boxen die bessere Lösung als die Strasse. Allerdings müsse man das betroffene Quartier Altstetten vor möglichen Auswüchsen schützen, damit es nicht zu einer Entwicklung wie am Sihlquai komme. Die CVP fordert, dass Stadt und Kanton in der Frage der Prostitution enger zusammenarbeiten. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit müsse die Frauen besser vor Menschenhändlern und Misshandlungen schützen.
Auch die städtische SP ist mit der Stossrichtung des Stadtrats zufrieden. Zentral sei der Schutz der Prostituierten. Zwar werde mit der Verlegung des Geschehens vom Sihlquai an die Aargauerstrasse die Lage der Wohnbevölkerung im Kreis 5 verbessert. Ob der neue Standort aber die Sicherheitsanforderungen erfülle, müsse sich noch zeigen. Begrüsst wird von der SP sodann, dass die Fensterprostitution Eingang in die Verordnung findet und dass eine Fachkommission eingesetzt wird. Die Grünen der Stadt Zürich sind grundsätzlich auch zufrieden, finden es aber schade, dass der Stadtrat das Sexgewerbe nicht als sittlich deklariert, so dass die Prostituierten Verträge gemäss dem OR abschliessen könnten. Den Freiern müsste es verboten sein, Sex ohne Kondom zu verlangen. Als wichtiges Ziel nennen die Grünen Massnahmen gegen den Menschenhandel.
Die Konzentration des Strichs auf drei Standorte halten die städtischen Grünliberalen für sinnvoll. Dass eine Fussgängerzone im Strichplan bleibe, dafür habe sich die Partei eingesetzt. Ob aber das Niederdorf dafür besser geeignet sei als das Langstrassenquartier, sei fraglich. Den neuen Regeln für die Salonprostitution begegnet die GLP kritisch. Es sei nicht einzusehen, warum legale Betriebe in Zonen mit mehr als 50 Prozent Wohnanteil geschlossen werden sollten. Für die Alternative Liste werden die Arbeitsbedingungen der Prostituierten zu wenig berücksichtigt. Das Meldeverfahren sei eine repressive Massnahme. Das sehen auch die Zürcher Stadtmission, die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration sowie die Zürcher Aids-Hilfe so.
Ein Modell des Strichplatzes mit Boxen - die Gebäude hinter dem Sichtschutz sollen einer Drittnutzung dienen. (Bild: NZZ/Christoph Ruckstuhl)


















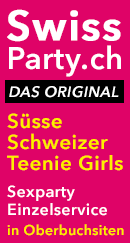




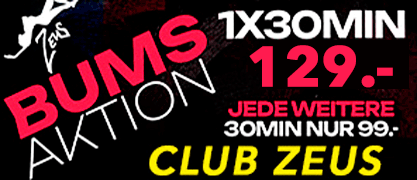

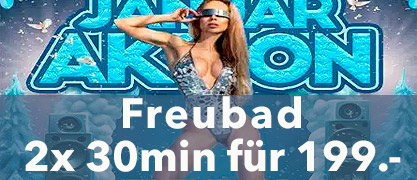

 wurde klein-check nicht richtig hart, doch spritzen hätte ich gleich schon können.
wurde klein-check nicht richtig hart, doch spritzen hätte ich gleich schon können. ausprobiert. ihr und meine stellung waren nicht optimal = übung abgebrochen. nochmals mit gummi angeblasen worden, aber es sollte heute einfach nicht sein. weiss der
ausprobiert. ihr und meine stellung waren nicht optimal = übung abgebrochen. nochmals mit gummi angeblasen worden, aber es sollte heute einfach nicht sein. weiss der  einfahren, doch was geschah? der lümmel gab den geist auf und spritze die sahne vor dem tor in die tütte.
einfahren, doch was geschah? der lümmel gab den geist auf und spritze die sahne vor dem tor in die tütte.  danach
danach