Seit Februar ist an der Universität Zürich ein Filter aktiv, der Zugriffe auf pornografische Internetseiten verhindern soll. Die Massnahme wirft grundsätzliche Fragen auf.
Die Universität Zürich hat ein Pornoproblem. Aus Sicht der Hochschule besteht dieses offenbar darin, dass an Computern auf dem Campus Pornofilme geschaut werden und dass es deswegen zu Beschwerden wegen sexueller Belästigung kommt. Die Universitätsleitung hat daraufhin entschieden, im unieigenen Netzwerk einen Filter einzurichten.
Dieser ist seit Mitte Februar aktiv. Seither werden Internetseiten mit pornografischen Inhalten blockiert. Die dabei verwendete Software indes ist fehlerhaft. Abgefangen werden auch unverdächtige Websites, was unter Studierenden bissige Kommentare auslöste.
48'000 Franken für viel Ärger
Publik gemacht hat die Geschichte der Chaos Computer Club Zürich (CCC), die NZZ berichtete umgehend darüber. In deutlichen Worten empörte sich der CCC über die «Zensur», die die Universität betreibe. Das Prinzip der Netzneutralität werde mit Füssen getreten. Ähnlich äusserte sich der studentische Verein Kritische Politik (kriPo). Der Verband der Studierenden der Universität Zürich (VSUZH) wollte gegenüber NZZ Campus keine Stellung nehmen. Man wolle die Thematik zuerst intern diskutieren.
Für Gesprächsstoff sorgt die Massnahme auch in den oberen Etagen der Universität. Abgesehen von den technischen Mängeln – nach Angaben der Hochschule kostet die von einer Firma erbrachte Dienstleistung 48'000 Franken pro Jahr – dürften dabei auch grundsätzliche Fragen zu reden geben: Ist es richtig, dass eine Universität den Zugang zum Internet kontrolliert? Ist ein solches Vorgehen vereinbar mit der Freiheit von Forschung und Lehre?
Freier Zugang an den Instituten
Erste Konsequenzen hat es bereits gegeben. Wurde der Filter zunächst an der ganzen Universität eingesetzt, ist der Webzugang an den Instituten seit einigen Tagen wieder frei. In öffentlichen Bereichen wie zum Beispiel den Bibliotheken ist das Tool jedoch weiterhin im Einsatz. Die Universität stellt sich auf den Standpunkt, dass es namentlich in solchen Räumen Reklamationen gegeben habe.
Zur Frage, wie oft sich die Hochschule mit Problemen wegen pornokonsumierenden Bibliotheksnutzern konfrontiert sehe, wollte sich der Medienverantwortliche Beat Müller gegenüber NZZ Campus nicht äussern. Müller teilt lediglich mit, es habe konkrete Beschwerden gegeben, worauf die Universitätsleitung beschlossen habe, das universitäre Netzwerk mit einem entsprechenden Filter zu versehen. Die Frage der Informationsfreiheit sei dabei ebenfalls erörtert worden.
Ein Schmutzfink in der ZB
Das Argument, die Hochschulangehörigen seien vor sexueller Belästigung zu schützen, wog schwerer. Doch mit dieser Güterabwägung sind offenbar nicht alle einverstanden. Neben Zustimmung, Kritik wegen der mangelhaften Technik gibt es laut Müller auch Stimmen, die den Filter prinzipiell in Frage stellen. Am Dienstag wird sich die Erweiterte Universitätsleitung noch einmal mit dem Thema befassen.
Zu diskutieren gäbe es Einiges. So könnten sich die Damen und Herren und die beiden Studierendenvertreter in dem Gremium darum bemühen, bei den Fakten zu bleiben. In der Zentralbibliothek Zürich (ZB) etwa, mit über 600 Lernplätzen die grösste Bibliothek an der Universität, ist es alles andere als an der Tagesordnung, dass sich Nutzer an pornografischen Inhalten im Internet ergötzen.
Claudius Lüthi, der stellvertretende Informationsleiter der ZB, kann sich auf Anfrage nur an einen Fall erinnern. Der Schmutzfink wurde aus dem Lesesaal verwiesen. Bei solchen Vorkommnissen ist eine Verwarnung vorgesehen. Im Wiederholungsfall kann die Bibliothek ein befristetes Hausverbot aussprechen. Das Problem lässt sich also auch ohne technische Hilfsmittel angehen.
Allein auf weiter Flur
Weiter könnte man sich fragen, ob andere Hochschulen bereits zu ähnlichen Massnahmen gegriffen haben. Zum Beispiel die ETH Zürich: Deren Kommunikationsstelle erklärt auf Anfrage, dass man keine automatischen Filter benütze, da diese dazu tendierten, auch unproblematische Seiten zu blockieren. Bei Missbrauch sei man auch so jederzeit in der Lage, den internen Nutzer zu eruieren.
Auch an der Universität Basel gibt es keine Bestrebungen, Zugriffe auf zweifelhafte Websites zu verhindern. Von Problemen wegen Internetpornographie haben weder Michael Brüwer, der Leiter des universitären Rechenzentrums, noch Andreas Brenner von der universitären Beratungsstelle sexuelle Belästigung gehört.
Eigenverantwortung?
Die Universität St. Gallen (HSG) verweist auf die Nutzungsbestimmungen, in denen Missbrauch der IT-Infrastruktur der Hochschule klar definiert ist. Gezielte Nutzung pornografischer Angebote kommt dort an erster Stelle. Wer trotzdem nicht widerstehen kann, riskiert, entdeckt zu werden. Die Internetaktivitäten der Hochschulangehörigen werden stichprobenweise analysiert. Spezielle Filter werden in St. Gallen jedoch keine verwendet. Die HSG betont, man setze auf die Eigenverantwortung der Nutzer.
Über die Eigenverantwortung ihrer Wissenschafter, Mitarbeiter und Studierenden könnte sich schliesslich auch die Universität Zürich Gedanken machen. Wer einen Filter gegen Pornoseiten installiert, handelt genau diesem Prinzip zuwider. Insofern bleibt kein Zweifel: Die Hochschule hat ein Pornoproblem. Sie hat es sich selbst eingebrockt.
Robin Schwarzenbach21.03.2014 - 16:10
Nicht an der Uni! – Aber braucht es dafür einen Filter? (Bild: Imago)
![]()
![]()
![]()


















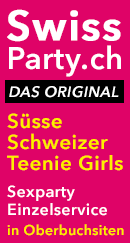




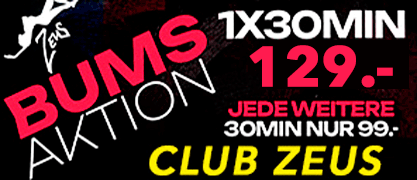

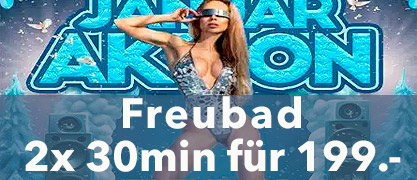

 macht richtig Spass. Auch wenn sie über mir sitzt und mir ihre Brüste zum liebkosen hinhängt ist das für mich der siebte Himmel.
macht richtig Spass. Auch wenn sie über mir sitzt und mir ihre Brüste zum liebkosen hinhängt ist das für mich der siebte Himmel.